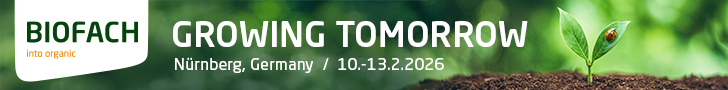Slow Food fordert fairen Handel mit Lebensmitteln
Angesichts globaler Krisen in der Lebensmittelversorgung fordert die Organisation Slow Food ein radikales Umdenken in der europäischen Handelspolitik. In ihrem neuen Positionspapier «What’s the Deal?» warnt sie vor den Folgen eines deregulierten Agrarhandels – und skizziert konkrete Wege hin zu gerechten, ökologischen Ernährungssystemen.

Ungleichheiten im globalen Lebensmittelhandel
Das aktuelle globale Handelsmodell – geprägt von Exportorientierung, deregulierten Märkten und der Konzentration wirtschaftlicher Macht – behindere den dringend nötigen Wandel hin zu krisenfesten Ernährungssystemen. Die Europäische Union trage als zentrale Handelsmacht eine besondere Verantwortung, dieses System zu hinterfragen und zu verändern, schreibt Slow Food in dem Positionspapier.
Ein zentrales Beispiel für die bestehende Schieflage: In der EU verbotene Pestizide werden weiterhin exportiert – unter anderem nach Kenia. «96 Prozent der Landwirt:innen in Kenia verwenden Pestizide», berichtete John Kariuki von Slow Food Kenia. Die meisten käme hochtoxischen Stoffe kämen aus China, viele stammten aber auch direkt aus der EU.
Prekäre Abhängigkeiten durch globale Lieferketten
Die aktuellen geopolitischen Spannungen, insbesondere die US-Zolldrohungen im Jahr 2025, hätten die Fragilität der globalen Versorgungssysteme schonungslos offengelegt, so Slow Food. Einseitige Entscheidungen einzelner Staaten könnten heute ganze Märkte destabilisieren – mit verheerenden Folgen für Millionen Menschen weltweit.
«Die prekäre Lage globaler Lebensmittelpreise und Lieferketten ist eine direkte Folge eines fehlerhaften Handelssystems», sagte Marta Messa, Generalsekretärin von Slow Food. «Die EU muss diesen Moment nutzen, um den Übergang zu agrarökologischen, lokalisierten und sozial gerechten Ernährungssystemen zu vollziehen.»
Das Positionspapier analysiert die historischen Wurzeln des aktuellen Ernährungssystems – von kolonialer Ausbeutung über die Industrialisierung der Landwirtschaft bis zur Entwertung von Lebensmitteln als reine Handelsware.
Als Gegenentwurf schlägt Slow Food eine an Agrarökologie, Ernährungssouveränität und regionalen Kreisläufen orientierte Politik vor.
Forderungen an die EU-Handelspolitik
Insgesamt formuliert Slow Food fünf zentrale Handlungsempfehlungen an die EU:
- «Spiegelmassnahmen» einführen, damit alle Importe EU-Standards bei Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen
- Subventionen für industrielle Massentierhaltung beenden
- Marktmacht neu verteilen – durch strengere Unternehmensverantwortung und demokratische Mitbestimmung in lokalen Ernährungssystemen
- Regionale Lieferketten fördern, um lokale Produzent:innen zu stärken
- Agrarökologie und faire Einkommen für Landwirte durch eine reformierte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) unterstützen
- Handelspolitik im Dienst der Menschen, nicht der Konzerne
«Europa muss aufhören, die wahren Kosten seines Konsums auszulagern», betont Messa. «Wir brauchen eine Handelspolitik, die Menschen nährt – nicht Konzerngewinne.»
Mit unserem beliebten Newsletter finden Sie die neusten Bio-Themen alle zwei Wochen direkt in Ihrem Posteingang.