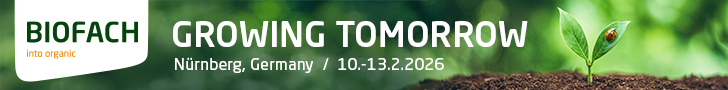Agrarbericht 2025: Belastet, aber zuversichtlich
Der neu veröffentlichte Agrarbericht 2025 zeigt, wie stark die Betriebe 2024 mit Wetterextremen, strukturellen Veränderungen und internationalem Preisdruck konfrontiert waren – und gleichzeitig, wie erstaunlich optimistisch viele Bauernfamilien in die Zukunft schauen.
 Der Agrarbericht zeigt auch eine Diskrepanz bei der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Schweiz: Offene Stalltüren sollen helfen, das romantisierte Bild der Landwirtschaft der Realität näherzubringen. Bild: LID/rho
Der Agrarbericht zeigt auch eine Diskrepanz bei der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Schweiz: Offene Stalltüren sollen helfen, das romantisierte Bild der Landwirtschaft der Realität näherzubringen. Bild: LID/rho
Wetterextreme treffen Pflanzenbau und Wein hart
2024 war für den Pflanzenbau eines der schwierigsten Jahre seit Langem. Christian Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), spricht von einem «nassen, kühlen Jahr», das vielerorts Erntearbeiten erschwerte, Böden längere Zeit unbefahrbar machte und den Krankheitsdruck massiv erhöhte.
Besonders betroffen war das Verarbeitungsgemüse, dessen Produktionsmenge rund 17 Prozent unter dem Durchschnitt der vorangegangenen vier Jahre lag. Auch die Kartoffelernte verfehlte den Referenzwert deutlich, weshalb der Bundesrat die Beiträge für Pflanzkartoffeln erhöhte – aus Sicht von Hofer ein «wichtiger Entscheid für die Ernährungssicherheit».
Noch deutlicher wurden die Folgen der Witterung im Rebbau. 2024 brachte die zweitgeringste Weinernte seit 50 Jahren. Frost, Mehltau und wiederholte Regenperioden reduzierten die Erträge drastisch. Gleichzeitig kämpft die Branche mit einem strukturellen Problem: Der Weinkonsum in der Schweiz sinkt und hat Schweizer Wein innert weniger Jahre zehn Prozent Marktanteil gekostet. Derzeit liegt er bei nur noch 35,5 Prozent.
Milchwirtschaft unter Druck
Die Milchproduktion blieb 2024 stabil und erreichte erneut rund 3,7 Millionen Tonnen – obwohl die Zahl der Betriebe weiter sinkt. Die Zahl der Milchproduktionsbetriebe ist innerhalb eines Jahres um 2,5 Prozent gesunken, und im Vergleich zu vor 25 Jahren existiert heute weniger als die Hälfte der Betriebe. Die verbleibenden Höfe werden grösser und spezialisierter: Die durchschnittliche Betriebsfläche stieg seit 2000 von 19 auf knapp 30 Hektaren.
Gleichzeitig steht die Milchproduktion wirtschaftlich stark unter Druck: Viele Betriebe berichten, dass die Milchproduktion kaum mehr attraktiv sei.
Mehr Frauen, mehr Zufriedenheit
Der Anteil von Frauen in der Betriebsleitung stieg 2024 auf 7,7 Prozent. Die Vollzeitbeschäftigung von Frauen nahm zu, jene der Männer leicht ab.
Bemerkenswert ist auch der Befund zur Lebensqualität: Bäuer:innen schätzen ihre Lebenszufriedenheit höher ein als noch vor vier Jahren – insbesondere dank Wertschätzung, Selbstständigkeit und Nähe zur Natur. Gleichzeitig bleiben Vorschriften und politische Unsicherheit starke Belastungsfaktoren.
Handelsbilanz auf historischem Tiefstand
Die Agrarhandelsbilanz fiel 2024 mit -4,8 Milliarden Franken so tief aus wie noch nie: Zwar stiegen die Exporte, die Importe aber noch stärker. Der Bund investierte 3,67 Milliarden Franken in Landwirtschaft und Ernährung, davon 2,8 Milliarden in Direktzahlungen.
Biodiversität: Qualität statt Fläche
Das Biodiversitätsmonitoring zeigt indessen erfreuliche Entwicklungen. Besonders in der Talzone stieg der Anteil an hochwertigen Biodiversitätsflächen der Kategorie QII. Im Berggebiet blieb die Biodiversität insgesamt höher, bedingt durch die topografisch begründete weniger intensive Bewirtschaftung. Der Fokus verschiebt sich damit immer stärker von der Quantität zur Qualität der Flächen.
Insgesamt zeigt sich, dass die Schweiz per 2024 zwar deutlich mehr ökologisch bewirtschaftete Flächen aufweist und weniger Mineraldünger einsetzt, die Umweltbelastung durch Stickstoff und Bodenbeanspruchung aber weiterhin hoch bleibt. Ausserdem macht das Monitoring des Agrarumweltsystems Schweiz (MAUS) den Konkurrenzdruck zwischen Futter- und Lebensmittelproduktion sichtbar: In vielen Regionen wird ein grosser Teil der Ackerflächen für Futtermittel genutzt.
Viel Zuversicht für 2025
Für 2025 überwiegt dennoch die Zuversicht. Günstige Witterung, stabile Märkte und gute Erträge lassen ein wirtschaftlich solides bis starkes Jahr erwarten. «Ich höre von überall, dass wir ein fast noch nie dagewesenes Jahr haben», so Hofer. Gleichzeitig warnt er vor neuen Risiken wie dem sich ausbreitenden Japankäfer und handelspolitischen Unsicherheiten, die im zweiten Halbjahr einzelne Produktsegmente belasten könnten.
Mit unserem beliebten Newsletter finden Sie die neusten Bio-Themen alle zwei Wochen direkt in Ihrem Posteingang.