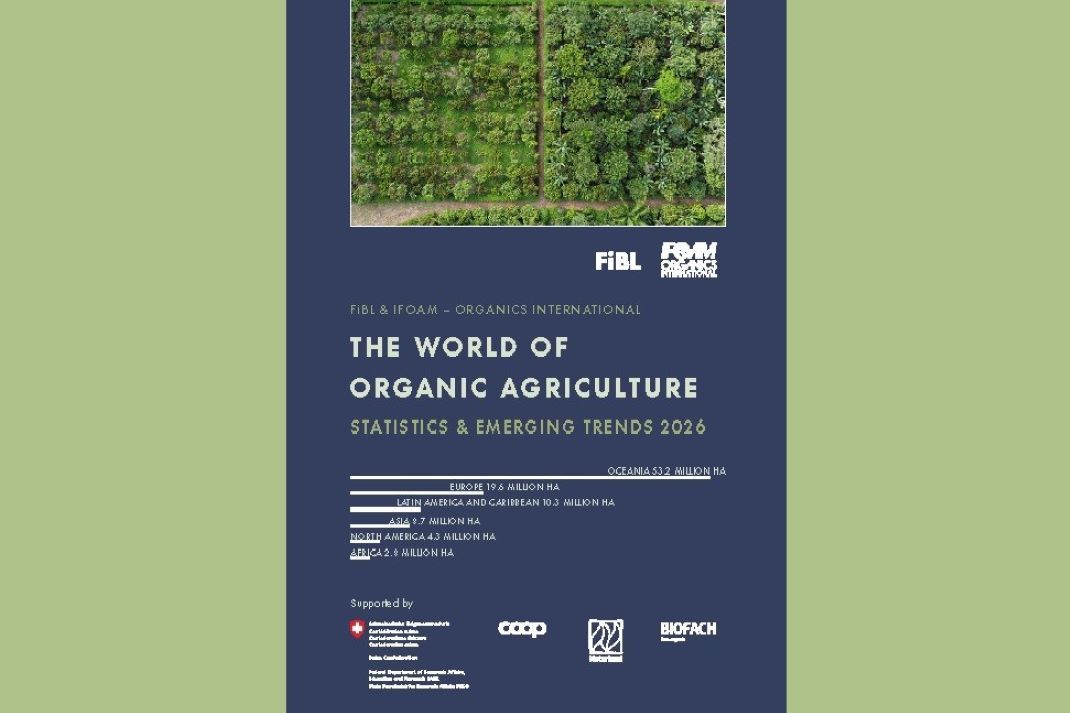Langzeitstudie zum Biolandbau
Der Biolandbau fördert Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität und schneidet bei Umweltwirkungen besser ab als die konventionelle Landwirtschaft. Bei Kulturen wie Getreide und Kartoffeln müssen die Erträge allerdings noch verbessert werden. Dies belegt eine gemeinsame Studie vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL und Agroscope.
 Auf 96 Parzellen vergleicht der weltweit einzigartige DOK-Langzeitversuch konventionelle und biologische Anbausysteme. Bild: FiBL
Auf 96 Parzellen vergleicht der weltweit einzigartige DOK-Langzeitversuch konventionelle und biologische Anbausysteme. Bild: FiBL
Seit 40 Jahren läuft in Therwil (BL) der sogenannte DOK-Versuch – ein Langzeitexperiment, das biologische und konventionelle Anbausysteme wissenschaftlich vergleicht. Die Studie von FiBL, Agroscope und der ETH Zürich zeigt nun: Biolandbau hat klare Vorteile für die Umwelt.
«Die akribisch gesammelten Daten belegen, dass der Biolandbau die Biodiversität sowie die Bodenfruchtbarkeit fördert», sagt Hans-Martin Krause vom FiBL, Co-Leiter des Versuchs. Auch negative Umweltwirkungen durch Pflanzenschutzmittel und Stickstoffüberschüsse seien im Biolandbau deutlich geringer.
Biolandbau verbessert Bodenfruchtbarkeit
Eine zentrale Erkenntnis der Studie: Bioböden enthalten 16 Prozent mehr Humus und weisen eine um bis zu 83 Prozent höhere Aktivität von Bodenorganismen auf. Das verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Wasserspeicherung und reduziert Erosion.
Entscheidend für fruchtbare Böden ist der Einsatz von Mist, idealerweise als Kompost.
Wird jedoch nur mit synthetischem Mineraldünger gearbeitet – wie in einem der untersuchten konventionellen Systeme – sinkt der Humusgehalt.
Allerdings nehmen die Phosphorgehalte in Bioböden stärker ab als in den konventionell bewirtschafteten, was den Bedarf an Phosphorzufuhr über Recyclingdünger zeigt, um im Biolandbau langfristig Phosphatmangel zu vermeiden.
«Besonders gut schneidet das biodynamische System in Sachen Bodenfruchtbarkeit, Humusaufbau und Klimawirkung ab», erklärt Paul Mäder, Mitautor der Studie. Der Grund: kompostierter Mist und pflanzliche Präparate.
Effiziente Erträge mit Schwankungen
Die Studie zeigt, dass Biobetriebe mit 85 Prozent der konventionellen Erträge wirtschaften – jedoch mit weit weniger Dünger und Pflanzenschutzmitteln.
Während Soja in beiden Systemen gleich hohe Erträge liefert, gibt es Unterschiede bei Futterpflanzen wie Kleegras und Silomais. Besonders bei Weizen und Kartoffeln bleiben die Bio-Erträge hinter denen des konventionellen Anbaus zurück.
Insgesamt schwanken die Erträge in den biologischen Systemen deutlich stärker. Das liegt am geringeren Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln. Dafür ist das Risiko einer Belastung von Gewässern, Lebens- und Futtermitteln durch Schadstoffe deutlich geringer.
Klare Klimavorteile – dennoch ähnlicher Fussabdruck
Weniger Stickstoffdünger bedeutet weniger klimaschädliches Lachgas. Pro Hektar hat der Biolandbau deshalb eine bessere Klimabilanz.
Doch weil die Erträge niedriger sind, ist der CO₂-Fussabdruck pro Produkteinheit ähnlich wie bei der konventionellen Landwirtschaft – mit Ausnahme des biodynamischen Systems, das mehr CO₂ im Humus speichert.
Zukunft: Bessere Nährstoffkreisläufe und robuste Sorten
Die Studie zeigt: Der Biolandbau hat Potenzial, braucht aber Weiterentwicklungen. «Wichtige Hebel sind das Recycling von Phosphor und Stickstoff aus Nahrungsabfällen oder Abwasser sowie eine gezielte Züchtung robuster Sorten», sagt Jochen Mayer von Agroscope.
Auch Diversifizierung im Pflanzenbau – zum Beispiel Mischkulturen, Untersaaten oder Streifenbau mit mehrjährigen Kulturen – könnte helfen, die Ertragslücken zu schliessen.
So könnte der Biolandbau langfristig noch effizienter werden – für die Umwelt und die Landwirtschaft gleichermassen.
Mit unserem beliebten Newsletter finden Sie die neusten Bio-Themen alle zwei Wochen direkt in Ihrem Posteingang.